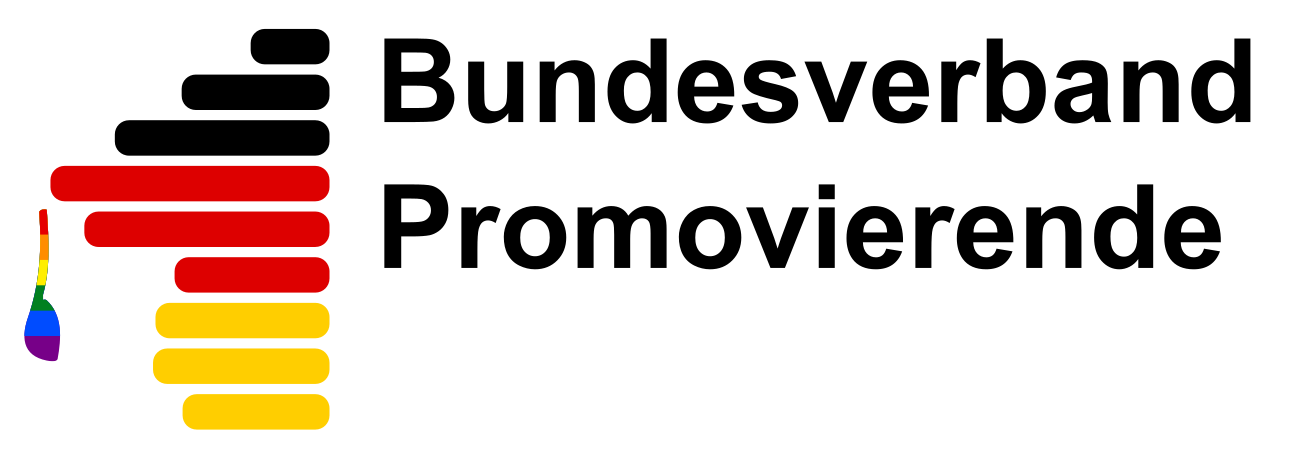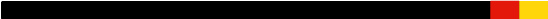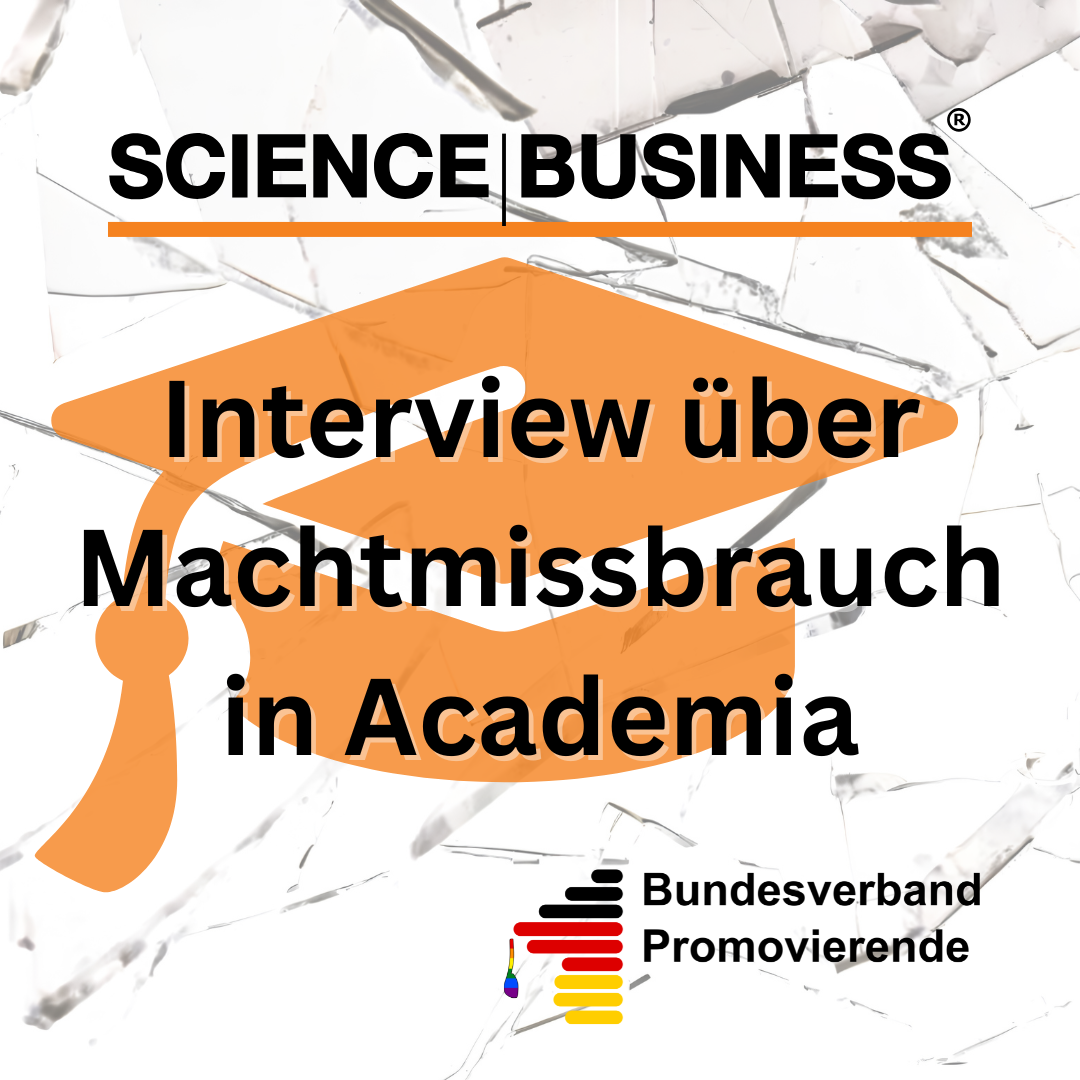Die Online-Plattform Science|Business hat eine Reihe von Kurzinterviews zu den aktuellen Berichten von Der Spiegel und DW geführt (siehe unseren Beitrag dazu). Die Plattform befasst sich allgemein mit der Verbindung von Industrie, Forschung und innovationsfördernder Politik. Sie bietet Nachrichten, Analysen und Einblicke in die europäische Forschungs- und Innovationspolitik sowie in Finanzierungsmöglichkeiten. Leon Chryssos, unser Programmbeauftragter, sprach mit ihnen darüber, dass nicht nur die Doktoranden innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft unter den genannten Problemen leiden.
Forschungseinrichtungen in Deutschland, darunter Max-Planck-Institute und traditionelle Universitäten, haben mit tief verwurzelten hierarchischen Strukturen zu kämpfen, die Promovierende vor Herausforderungen stellen. Das Machtgefälle ist eklatant: Professor:innen haben gleichzeitig die Autorität als Arbeitgeber und Prüfer:in von Dissertationen inne, während die Doktorand:innen oft mit befristeten Teilzeitverträgen arbeiten, was sie angreifbar macht. Darüber hinaus sind internationale Forschende besonders gefährdet, da ihr Visum, ihre Stipendien und ihre Finanzierung oft an ihre Position gebunden sind, was sie davon abhält, Fehlverhalten oder Probleme am Arbeitsplatz zu melden. Die Unterstützungssysteme für Promovierende sind oft unzureichend, mit erheblichen Unterschieden in Qualität und Zugänglichkeit. Viele Forschende, insbesondere aus dem Ausland, haben Schwierigkeiten, Kontakte zu Universitätsnetzwerken oder Studentenvertretungen zu knüpfen. Den bestehenden Beschwerdemechanismen mangelt es häufig an Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, was zu Vertrauensbrüchen führt und die Betroffenen davon abhält, ihre Bedenken zu äußern.
Der jüngste Skandal innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft hat die Aufmerksamkeit erneut auf diese Schwachstellen gelenkt. Aber dieses Problem ist „wohlbekannt und wenig beschrieben oder formal untersucht“, sagte Nicola Dengo, Vizepräsidentin von EuroDoc, dem Europäischen Rat der Promovierenden und Nachwuchsforscher. „In der akademischen Welt gewöhnt man sich daran, aber es ist nicht normal. Wie der Bericht weiter ausführt: Im Vereinigten Königreich hat eine Studie im Jahr 2020 ergeben, dass 43 % der befragten jungen Forscher:innen Belästigung oder Mobbing erlebt haben, wobei 61 % bereits während ihrer akademischen Laufbahn Zeuge davon geworden sind.
Promovierende, die eine Lösung für Probleme im akademischen Umfeld suchen, können sich an ihre lokale Ombudsperson wenden. Dieses Ombudssystem sollte als vertrauliche und unparteiische Anlaufstelle für die Lösung von Konflikten dienen. Aber wie Hjördis Czesnick feststellt, „gibt es eine Diskrepanz zwischen dieser riesigen [Web-]Seite mit Beratungsstellen und den vielen Leuten, die sagen: Ich habe mich nicht geholfen gefühlt.“ Er ist Leiter der Ombudsstelle für wissenschaftliche Integrität in Deutschland. Eine vergleichbare Struktur gibt es an der Universität Gent in Belgien mit dem gleichen Problem: „Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Leute von den Trustpunt-Diensten erwartet haben, und dem, was Trustpunt angeboten hat“, sagt Femke De Backere, „deshalb glauben die Leute nicht mehr an diese Mechanismen.“ Sie war eine Interessensvertreterin für junge Forscher:innen an der Universität Gent.
Wir empfehlen dir dringend, den vollständigen Artikel von Leonie Klingberg auf der Website von science|business zu lesen. Wenn du an Lösungen für diese strukturellen Probleme in unserem akademischen System arbeiten möchtest, wende dich an uns. Wir haben mehrere Arbeitsgruppen und sind immer auf der Suche nach Unterstützung in unserem Einsatz für bessere Forschungsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler.